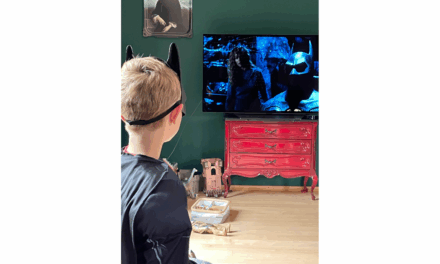Geld. Das ist die Antwort, die die meisten der für diesen Artikel interviewten Personen auf die Frage gegeben haben: „Was hätte Ihnen geholfen, sich in den ersten Jahren in Luxemburg besser einzuleben“. Mehr Geld hätte den Befragten helfen können, eine Wohnung zu mieten, die Flüchtlingsunterkünfte zu verlassen, homophoben Beleidigungen und sozialer Ausgrenzung zu entgehen. „Für viele LGBTIQ+ Menschen, die vor Verfolgung und Anfeindungen in ihren Heimatländern fliehen, bleibt das Versprechen auf Sicherheit im luxemburgischen Asylsystem oft hinter den Erwartungen zurück. Zwei von ihnen kamen im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der syrischen Flüchtlingskrise. Die beiden anderen sind aktueller. Zwei der Protagonist:innen wollten anonym bleiben, die beiden anderen sprachen offen. Alle haben ihr Recht auf Asyl geltend gemacht und haben dabei schwere Zeiten durchgemacht.
Ich bin zu feminin, um lesbisch zu sein
Es ist unklar, wie viele queere Menschen in Luxemburg Asyl beantragen. Das Innenministerium und seine für Asylanträge zuständige Einwanderungsabteilung führen keine Aufzeichnungen über die Gründe für das Ersuchen um internationalen Schutz im Großherzogtum. Das Ministerium veröffentlicht monatlich die Zahl der Asylanträge, die Zahl der angenommenen und abgelehnten Anträge sowie die Herkunftsländer. Ob die Menschen wegen eines Krieges, als politische Geflüchtete oder wegen geschlechts- oder sexualitätsbezogener Bedrohung und Gewalt aus ihren Ländern geflohen sind, wird in diesen Statistiken nicht erfasst. Informationen über die Aufnahmequote speziell für LGBTI+ Menschen gibt es daher nicht.
Was wir jedoch wissen, ist, warum queere Menschen abgewiesen werden. Die Hilfsorganisation für Geflüchtete Passerell Asbl stößt in ihrer Praxis auf zwei Gründe. Ihre Direktorin Marion Dubois erklärt: „Die Behörden behaupten entweder, dass die Verfolgung von LGBTIQ+ Menschen in ihrem Land nicht so schlimm sei und nicht den Anforderungen der Genfer Konvention entspreche.“ Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Land ein Gesetz zur Entkriminalisierung von Homosexualität verabschiedet hat oder wenn es Mechanismen zur Verteidigung der Rechte von LGBTIQ+-Personen gibt, sei es durch Organisationen der Zivilgesellschaft oder durch die Polizei. „Oder sie denken, dass die Person nicht wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein, dass sie zum Beispiel nicht wirklich homosexuell ist.“
Genau das ist Betty, der ersten unserer Protagonist:innen, passiert. Betty trägt metallisch pinkes, gelocktes Haar, zwei Nasenpiercings, lange Wimpern und perfektes, unsichtbares Make-up mit rosa Lidschatten und Lippenstift.
Sie denken, ich sei zu feminin, um lesbisch zu sein. Sie glauben mir nicht. Das ist so beleidigend. Während des Interviews fragten sie mich nach meiner ersten Erfahrung, meiner ersten Liebe. Aber sie sagten mir, dass ich es nicht romantisch klingen lassen würde. Warum sollte ich? Es ist über ein Jahrzehnt her; ich bin darüber hinweg. Sie fragten, ob ich in einer Beziehung sei. Ich war damals mit einem Mädchen zusammen und habe ihnen sogar ein Foto von uns gegeben, auf dem wir uns auf der Straße küssen – etwas, das ich in meinem Land nicht machen darf. Sie sagten, so ein Foto könne jeder machen, und es zeige nicht wirklich, ob es Liebe sei. Wie kann ich Liebe beweisen? Ich habe ihnen Bilder gezeigt, auf denen ich mit meinen Freund:innen auf der Pride zu sehen bin. Ich habe sie sogar gefragt, ob sie intime Bilder oder Videos von mir und einem Mädchen sehen wollen. Ich habe sie. Ich kann sie euch zeigen, sagte ich. Sie sagten, nein, das müssen Sie nicht. Und ich sagte, was soll ich euch dann noch zeigen? Es ist wirklich ermüdend.
Betty kam 2022 nach Luxemburg. Jahre zuvor hatte sie in den Niederlanden gelebt. Im Jahr 2011 wurde sie aus Äthiopien dorthin verschleppt. Mit dem Versprechen auf Bildung und Arbeit hatte sie ihr Land gerne verlassen. Sie wollte Journalistin werden. Betty möchte nicht über ihre ersten Jahre in den Niederlanden sprechen, darüber, was sie tun musste, um ihre Schuld bei den Menschenhändlern zu begleichen. „Das bringt mich an dunkle Orte“, sagt sie. Aber sie ist trotzdem dort angekommen. Während ihrer Zeit im Primo Accueil Zentrum Shuk hat sie versucht, sich umzubringen. „Es gab nur zwei Mädchen und eine Familie im ganzen Gebäude. Es war so leer. Ich war so niedergeschlagen, und ich hatte gerade meine Ablehnung erhalten“, sagt sie. Danach war sie zwei Monate lang im Krankenhaus und wurde dann in ein anderes Heim verlegt.
Als Betty nach Luxemburg kam, war die Einwanderungsbehörde misstrauisch. Sie hatte bereits vor ein paar Jahren in den Niederlanden Asyl beantragt. Sie war 19 Jahre alt, als sie nach Europa kam. Nach einiger Zeit gelang es ihr, ihre Menschenhändler anzuzeigen und während des Verfahrens Polizeischutz zu erhalten, aber die Ermittlungen führten zu nichts, und als die Anzeige fallen gelassen wurde, verlor Betty ihren Schutzstatus. Sie beantragte aufgrund ihrer Sexualität Asyl, wurde aber abgelehnt. Seitdem lebte sie ohne Papiere in den Niederlanden und arbeitete in nicht angemeldeten Jobs in Restaurants. Auch in Luxemburg wurde ihr Antrag abgelehnt. Jetzt wartet sie auf die Berufung vor Gericht.
Ich bin hierher gekommen, weil ich einen Aufenthaltstitel haben wollte. Ich habe das Gefühl, dass ich in den Niederlanden keine Hoffnung habe. Ich habe versucht, hier Asyl zu beantragen, aber auch das hat nicht geklappt. Aber ich glaube nicht, dass das Urteil in den Niederlanden gerecht war. Ich kann nicht in mein Land zurückkehren. Ich kann dort nicht ich selbst sein. Ich werde mein Leben nie so leben können, wie ich es leben will, ich muss mich immer zurückhalten und mich verstellen. Als ich meine erste Erfahrung machte und meine Familie davon erfuhr, brachten sie mich in die Kirche, um Weihwasser zu holen, als ob ich krank wäre und davon geheilt werden müsste. Danach habe ich so getan, als wäre jetzt alles in Ordnung. In den Niederlanden habe ich versucht, mit einem Mann zusammen zu sein und dieses traditionelle Familienleben aufzubauen. Ich dachte, das ist etwas, das ich reparieren kann.
Als Anwalt hat Franck Greff viele queere Asylbewerber:innen während ihres Verfahrens begleitet. Er hilft ihnen, alle Beweise zu sammeln, die die Einwanderungsbeamt:innen sehen müssen, und bereitet sie auf die Anhörung vor. „ Die Person, die internationalen Schutz beantragt, muss ihre Geschichte so vollständig und fundiert wie möglich schildern“, sagt er. „Das Ministerium kann verstehen, dass es in manchen Ländern kompliziert ist, Beweise zu bekommen, aber wenn man erst einmal ein paar Monate in Luxemburg ist, kann man beweisen, dass man in Kontakt mit der Community steht, dass man an der Pride oder an Veranstaltungen, die von der Community organisiert werden, teilnimmt. Selbst wenn die Person ihre sexuelle Orientierung nicht in den sozialen Medien zur Schau stellen möchte, gibt es 1.000 Möglichkeiten, den Nachweis zu erbringen. Sie können zum Rainbow Center gehen, ohne dass jemand sie sieht.“
In Franck Greffs Augen ist das System fair. Wenn die Menschen bereit sind, die für die Bewertung ihres Falles erforderlichen Informationen zu liefern, stehen die Chancen gut, den Schutzstatus zu erhalten, sagt er. Er ist überzeugt, dass das Ministerium und er das gleiche Ziel verfolgen: diejenigen, die Schutz brauchen, zu schützen. „Wenn eine Person aufgrund ihrer Homosexualität in ihrem Herkunftsland in Gefahr ist, muss diese Person geschützt werden. Darüber kann es keine Debatte geben. Aber es ist äußerst wichtig, dass wir sicher oder zumindest fast sicher sind, dass die Person in ihrem Land wirklich in Gefahr ist. Um dies festzustellen, werden die Bewerber:innen stunden- oder sogar tagelang befragt. Franck Greff erinnert sich an den Fall eines schwulen Mannes aus Bangladesch, der sechs Tage lang befragt wurde. Greff und Passerell sind sich einig, dass dies eine gute Sache ist. Die Menschen bekommen Zeit, ihre Geschichte zu erklären. Die Entscheidung wird auf der Grundlage einer gründlichen Untersuchung getroffen.
In Bettys Fall reichte das von ihr vorgelegte Material jedoch nicht aus, um zu beweisen, dass sie diejenige ist, die sie vorgibt zu sein.
Dank all dieser Unterstützung konnte ich diese positive Entscheidung treffen
Und auch für unseren zweiten Protagonisten hätte es viel einfacher sein müssen, in Luxemburg Asyl zu bekommen. René war ein bekannter LGBTIQ+-Aktivist in seinem Heimatland Russland. Er organisierte die Moscow Pride und war einer der letzten lautstarken LGBTIQ+- Aktivisten Russlands, bevor die homophoben Gesetze 2013 jegliche offene Queerness verboten und zu einem starken Anstieg homophober Gewalt führten. In Moskau wurde René von der Polizei verfolgt und von queerfeindlichen Menschen angegriffen, sobald er das Haus verließ. Aus Angst vor einer Verhaftung konnte er seine gebrochene Nase nicht im Krankenhaus behandeln lassen. All dies ist gut dokumentiert. Seine Geschichte wurde in Dutzenden von internationalen Zeitungen veröffentlicht. Die Beweise dafür, dass sein Leben in Russland in Gefahr war, waren gut greifbar. Dennoch hatte er das Gefühl, dass es ihm schwer fiel, die Einwanderungsbehörden zu überzeugen.
Ich habe im Jahr der Migrationskrise um politisches Asyl gebeten. Ich war ein ganz anderer Fall als die Syrer, und ich nehme an, sie wussten nicht, was sie tun sollten. Es war, als wäre ich der erste queere Geflüchtete. Dank meines Aktivismus erhielt ich all diese Unterstützung von der Öffentlichkeit und den Medien, von Amnesty International, von Rosa Lëtzebuerg und Centre LGBTIQ+ Cigale. Ich habe Interviews für Le Quotidien und Woxx gegeben und ich glaube, dass ich dadurch meinen Status bekommen habe. Im Jahr 2015 waren wir drei Schwule aus Russland. Einer bekam eine Absage. Der zweite war ein sehr enger Freund von mir. Mehr als ein Jahr lang hat er im Foyer in Wiltz gewartet, und als er eine Absage bekam, war er völlig am Ende und sprang von einer Brücke. Selbstmord. Es gibt also drei Schwule aus Russland, und nur ich habe diesen positiven Bescheid bekommen, und ich denke, das verdanke ich all dieser Unterstützung.
Der Fall von Renés Freund Sergueï Vladimirov, der sich das Leben nahm, wurde damals in den Medien diskutiert, aber die Berichterstattung hatte keine bekannten Folgen. Heute ist die Situation immer noch schwierig. Das Leben in den Unterkünften ist für alle, die auf eine Antwort der Behörden warten, von Ungewissheit geprägt, was die Enge schwer erträglich macht. Für LGBTIQ+-Asylsuchende, die sich offen als queer bekennen, ist die Situation jedoch oft noch schlimmer. René wartete 15 Monate auf seine Aufenthaltsgenehmigung.
Es war furchtbar. Zuerst war ich auf dem Limpertsberg. Es war ein sehr großes Foyer und extrem überfüllt. Ich hatte das Gefühl, dass ich die gleiche Scheiße erlebe wie in Russland, die gleiche Diskriminierung, den gleichen Hass, all diese Kommentare, all diese Beleidigungen. Da war ein Typ aus Kosovo, er war auch schwul, und niemand wollte im Speisesaal neben uns sitzen, weil das haram ist. Ich habe ein paar Interviews gegeben, und die Zeitungen mit meinem Gesicht auf der Titelseite lagen in den Gemeinschaftsräumen zum Lesen aus. Jeder wusste alles. Es war so ein beengender Ort. Um rauszugehen und etwas zu unternehmen, braucht man Geld. Ich hatte diesen Reiseausweis für Geflüchtete, mit dem ich die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen konnte. Ich bin also durch das ganze Land gereist, habe mir alle Schlösser und Wälder, alle Seen und Flüsse und fast jedes Dorf angesehen. Ich ging zu Treffen zwischen Einheimischen und Geflüchteten, aber es schien, als sei ich zu weiß, um ein Geflüchteter zu sein. Damals wollten die Menschen Solidarität zeigen, und die Medien spielten mit stereotypen Bildern von Geflüchteten. Die Leute haben mich also ignoriert, und nachdem ich gesagt hatte, dass ich ein schwuler Aktivist bin, dass ich trans bin, wurde ich nie wieder zu solchen Veranstaltungen eingeladen.
Später war ich in einer Unterkunft in Schifflange. Ich war der luxemburgischen Regierung, dem ONA und dem Roten Kreuz dankbar, dass sie mir ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellten. Aber ich teilte die Gemeinschaftsräume wie Küche, Bad und Dusche mit anderen Geflüchteten, die mich schikanierten. Ich habe immer offen gesagt, wer ich bin, ich habe ihnen gesagt, dass ich schwul bin, dass ich queer bin, dass ich trans bin. Einmal kam einer von ihnen auf mich zu und sagte: „Es ist mir egal, wie du dich nennst, wenn du eine Vagina hast, werde ich dich ficken.“ Ich bin nur knapp der Verfolgung durch die Behörden entgangen. Ich wurde in Polizeigewahrsam millionenfach gefoltert. Ich habe also nicht daran gedacht, dass ich zur Polizei gehen könnte, ich war völlig blockiert. Ich lebte diesen Albtraum, jeden Tag, jede Nacht. In Berlin, in Amsterdam, in anderen Ländern gibt es queere Schutzräume. Was zum Teufel ist mit diesem Land los?
René hat sich für die Einrichtung von Unterkünften für queere Geflüchtete eingesetzt. Das Nationale Aufnahmebüro ONA, das die meisten Unterkünfte für Geflüchtete verwaltet, erklärt jedoch: „Alle ONA-Unterkünfte sind gemischte Strukturen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Diese Vielfalt ermöglicht es den Menschen, sich an das multikulturelle Umfeld in Luxemburg zu gewöhnen. Außerdem gehören gegenseitiger Respekt und kulturelle Akzeptanz zu den gelebten Werten in den Wohneinrichtungen und sind in den internen Regeln verankert.“ Worte, die für Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie René gemacht haben, schwer zu schlucken sein müssen.
Die Sozialarbeiter:innen des ONA und des Roten Kreuzes geben an, dass ihre Mitarbeiter:innen eine spezielle Schulung des LGBTIQ+ Zentrums CIGALE erhalten haben, um queere Menschen besser zu verstehen und zu unterstützen. Andre Soares de Andrade, der für den Dienst „Migrant:innen und Geflüchtete“ des Roten Kreuzes zuständig ist, sagt: „Wir versuchen, ein Vertrauensverhältnis zu jeder Person aufzubauen, und wenn nötig, verstärken wir unsere Präsenz und Interaktionen.“ Trotz aller Verfahren haben die Menschen Mühe, die Unterstützung zu finden, die sie brauchen.
Man wird in denselben Raum mit denselben Leuten gesteckt, vor denen man geflohen ist
Unser dritter Protagonist, Haval*, war 18 Jahre alt und schwer traumatisiert, als er ankam. Er kam 2020 nach Luxemburg, das zweite Mal, dass er aus einem Land floh. Haval hatte bereits Jahre zuvor sein Herkunftsland Syrien zusammen mit seiner kurdischen Familie verlassen. Er war elf Jahre alt, als sie in die kurdische Stadt Erbil im Irak zogen. Dort lebte er sieben Jahre lang mit seiner Familie, bis er alles hinter sich lassen und ein neues Leben in Luxemburg beginnen musste.
Meine Familie fand heraus, dass ich schwul bin, als ich es einer meiner Schwestern erzählte. Sie war sehr aufgeschlossen und hatte keine Probleme, mich zu akzeptieren. Also hat sie es allen erzählt, weil sie dachte, dass alle genauso reagieren würden. Aber das war nicht der Fall. Meine anderen Schwestern und der Rest meiner Familie waren wirklich dagegen, und sie erzählten es meinen Onkeln, und alle mischten sich ein. Sie meinten, „er wird den Ruf der Familie ruinieren, und wir müssen ihn loswerden“. Sie wollten mich umbringen.
Meine Mutter half mir, sie bezahlte den Schmuggler, und die Entscheidung, wegzulaufen, fiel innerhalb weniger Tage. Als ich hier ankam, war ich wirklich erschüttert. Deine Familie, die du für sicher hältst, wird über Nacht zum gefährlichsten Ort für dich; und dann bin ich weggelaufen. Und ich fragte mich: Wer bin ich? Ich habe keine Beziehung mehr zu diesen Menschen. Aber ich war auch in einem fremden Land, ich war in Luxemburg, und auch hier hatte ich keine Beziehung zu den Menschen. Ich hatte eine solche Identitätskrise, weil ich nicht wusste, wo ich hingehöre. Ich habe das Gefühl, dass wir als Menschen irgendwo dazugehören müssen, sonst können wir nicht funktionieren.
Ich war wirklich deprimiert, und die Atmosphäre im Foyer machte es für mich noch schlimmer, da ich von Menschen umgeben war, die mich nicht akzeptierten. Sie stecken dich in denselben Raum mit denselben Leuten, vor denen du weggelaufen bist. Wenn ich in die Küche ging, um mir etwas zu essen zu machen, sprach niemand mit mir, aber es wurde geflüstert und gelacht, und ich wusste, dass sie sich über mich lustig machten. Ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer und habe mit niemandem gesprochen.
Ich hatte ein paar Sitzungen mit den Psycholog:innen im Foyer, und dann sagten sie, wir können Ihnen nicht wirklich helfen, Sie müssen zu einem Psychiater gehen. Der Psychiater hörte mir 10 Minuten lang zu und verschrieb mir ein paar Medikamente. Er war nicht wirklich hilfreich. Und man muss um psychologische Unterstützung bitten. Sie fragen dich nicht, ob du sie brauchst.
Passerell Asbl kritisiert dieses Vorgehen. Marion Dubois sagt: „Von Asylsuchenden wird Eigeninitiative verlangt, wenn es um ihre Gesundheit geht, sowohl physisch als auch psychisch.“ Organisationen, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen, fordern einen Mechanismus zur frühzeitigen Erkennung von Gefährdungen durch die Einwanderungsbehörden in Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Psychiat:rinnen und Psycholog:innen sowie der entsprechenden öffentlichen Sozialhilfe, um eine angemessene medizinische und soziale Betreuung zu gewährleisten. Laut ONA werden LGBTIQ+-Geflüchtete, sobald sie sich in den Unterkünften und damit in ihrer Obhut befinden, „als ‚gefährdet‘ betrachtet und profitieren von zusätzlicher Betreuung und psychologischer Unterstützung, insbesondere wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Das ONA arbeitet eng mit NGOs wie z.B. CIGALE zusammen.“ Andre Soares De Andrade vom Roten Kreuz unterstreicht: „Wir analysieren und ermitteln systematisch die Schutzbedürftigkeit aller Neuankömmlinge, die internationalen Schutz suchen. So können wir die spezifischen Bedürfnisse der Neuankömmlinge einschätzen.“ All diese Mechanismen haben unsere Protagonisten im Stich gelassen.
Ich fühle mich frei. Ich habe Arbeit. Ich habe alles
Haval geht es heute gut. Seit er eine Gastfamilie gefunden und es geschafft hat, aus dem Heim auszuziehen, geht es ihm besser. Er hat begonnen, an der Universität zu studieren und umgibt sich nur noch mit queeren und queer-freundlichen Menschen. Er hat einen Psychologen gefunden, der ihm hilft. Andere hatten nicht so viel Glück. Während Betty immer noch auf ihren Geflüchtetenstatus wartet, hat René das Gefühl, dass er darin feststeckt. Eine Umgebung, die ihn mehr unterstützt, hätte ihm helfen können.
Yasser kam 2015 aus Syrien. Er war 25 Jahre alt und floh aus seinem Land zusammen mit Millionen von anderen Geflüchteten. Er fürchtete Verfolgung, weil er schwul ist, und auch seine Familie akzeptierte seine Sexualität nicht. Also ging er weg, um sich zu schützen. Yasser verbrachte 20 Monate in den Flüchtlingsunterkünften, bevor sein Recht auf Asyl gewährt wurde. Damals wurden Anträge von syrischen Kriegsflüchtlingen generell akzeptiert, unabhängig von ihrer Sexualität oder ihrem Geschlecht. Yasser hatte einen Freund in Luxemburg, der ihn während des Verfahrens unterstützte. Er lebte seine Sexualität nicht offen aus, so dass er nicht belästigt wurde. Sein einziges Problem war das Geld: „Ich hatte nur 25 Euro im Monat“, sagt er. „Aber ich rauche nicht, also war es in Ordnung.“
Ich wurde zweimal vom Ministerium befragt. Sie waren nett. Sie haben mir nur allgemeine Fragen gestellt. Warum sind Sie hierher gekommen? Warum haben Sie sich für Luxemburg entschieden? Sie empfahlen mir Gruppen, wo ich hingehen konnte. Natürlich hatte ich in dieser Zeit Angst. Ich wusste nicht, wie meine Zukunft aussehen würde. Mein Freund hat mir geholfen. Er hat mich manchmal zu sich nach Hause eingeladen. Wir haben zusammen gekocht und ich habe dort übernachtet. Und die Unterkunft war nicht zu überfüllt. Es war wie ein Hotel mit zehn Personen, zwei Personen pro Zimmer. Direkt nach meiner Ankunft wurde ich dorthin verlegt, in den Norden von Luxemburg. Für mich war alles in Ordnung. Für andere Menschen war es vielleicht anders, aber für mich war alles perfekt. Ich hatte alles, was ich brauchte.
Sein Rat an alle anderen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, lautet:
Seid stark, habt Geduld. Ich glaube nicht, dass sich die Dinge in Syrien ändern werden. Man kann die Religion nicht ändern. Was Kindern in der Familie beigebracht wird, ist wie eine Gravur im Marmor, es bleibt für immer. Die Menschen sollten nach Freiheit streben, denn Freiheit ist möglich. Wähle, wo du leben und hingehen willst. Hier kannst du dich frei fühlen. Ich fühle mich frei. Ich habe Arbeit. Ich habe alles.
*Die Person möchte anonym bleiben, daher hat die Redaktion zugestimmt, ihr einen anderen Namen zu geben.
Artikel aus dem Englischen übersetzt.